|  2. Was ist unter „Mobbing“
zu verstehen?
2. Was ist unter „Mobbing“
zu verstehen?
 2.1 Definition von „Mobbing“
2.1 Definition von „Mobbing“
Das Konzept des Mobbings ist relativ neu,
es wurde vor allem in den skandinavischen Ländern entwickelt
und beforscht. Einer der Hauptbegründer und Hauptvertreter
der Mobbingforschung, der den Begriff zu Beginn der 90er Jahre
auch in die deutschsprachige Literatur eingeführt hat,
ist Leymann (1993, 1995; vgl. Dick 1999, 99).
Mobbing (engl. mob – Pöbel,
randalierender Haufen) beschreibt nach Leymann (1993) feindselige
Interaktionen und Konflikte am Arbeitsplatz, die sich dauerhaft
und systematisch gegen eine Person richten.
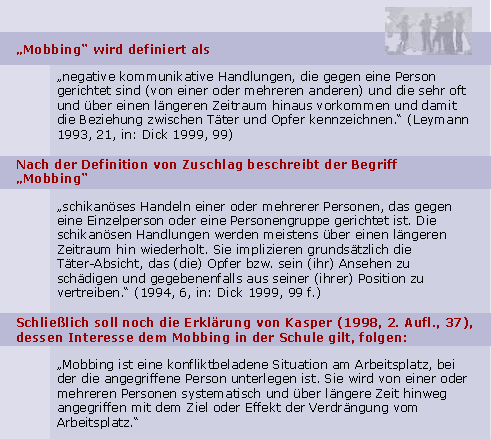
Leymann (1993, 32; vgl. auch
in: Dick 1999, 100) grenzt ab: Werden Mobbinghandlungen nur
einmal ausgeführt, können sie als bloße Unverschämtheit
oder evt. sogar als Scherz gewertet werden. Treten sie jedoch
wiederholt auf und erstrecken sich über einen längeren
Zeitraum, dann kann von Mobbing oder Psychoterror am Arbeitsplatz
gesprochen werden. Auch Kasper (1998, 2. Aufl., 17) macht
deutlich, daß durch den Zusammenhang in einer Kette
häufiger, gezielter Maßnahmen das wird, was wir
heute unter Mobbing verstehen.
 2.2 Der Weg in die Mobbing-Katastrophe (Phasenmodell)
2.2 Der Weg in die Mobbing-Katastrophe (Phasenmodell)
Das Phasenmodell nach Leymann (1993, 59)
und Esser/Wolmerath (1997, 23) wurde von Kasper (1998/2. Aufl.,
27) ergänzt durch Erkenntnisse aus seinem Buch (vorliegendes
Material betroffener Lehrer/-innen).
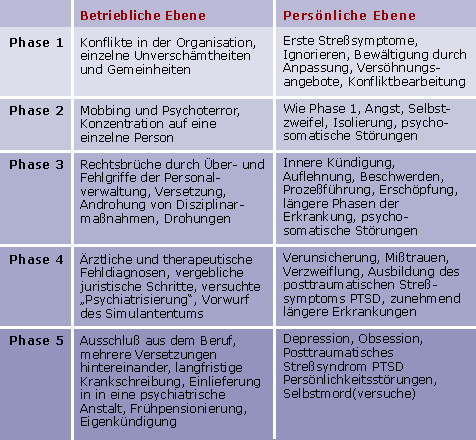
PTSD siehe unter „Auswirkungen
von Mobbing“
Des weiteren geht Leymann (in: Kasper 1998,
2. Aufl., 9) darauf ein, daß den Mobbingopfern oft ungerechtfertigterweise
eine Eigenschuld oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale
zugeordnet werden. Jedoch sind scharf frustrierende Lebensbedingungen,
die Menschen gegeneinander aufhetzen, die Ursache. Eine Mobbingwelt
ist letztendlich eine Welt schlechtester organisatorischer
Vorgaben.
Leymann (in: Kasper 1998, 2. Aufl., 11)
formuliert so:
„Mobbing hat nichts mit der
Persönlichkeit des Opfers zu tun. Es geschieht massenhaft,
und es kann jeden einmal treffen.“
 2.3 Die fünf Kategorien des Mobbingprozesses nach Leymann
2.3 Die fünf Kategorien des Mobbingprozesses nach Leymann
(Leymann 1993, 33 f.; vgl. auch in: Dick
1999, 100; Ausfelder 2000, 35 f.; Kasper 1998, 2. Aufl., 23
f.) (Weibliche und männliche Form der/des Betroffenen
wechselweise.)
1. Angriffe
auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen
- Der Vorgesetzte schränkt die Möglichkeit
ein, sich zu äußern.
- Man wird ständig unterbrochen.
- Kollegen schränken die Möglichkeit ein, sich
zu äußern.
- Anschreien oder lautes Schimpfen.
- Ständige Kritik an der Arbeit.
- Ständige Kritik am Privatleben.
- Telefonterror.
- Mündliche Drohungen.
- Schriftliche Drohungen.
- Kontaktverweigerung durch abwertende Blicke oder Gesten.
- Kontaktverweigerung durch Andeutungen, ohne daß
man etwas direkt anspricht.
2. Angriffe
auf die sozialen Beziehungen
- Man spricht nicht mehr mit dem/der Betroffenen.
- Man läßt sich nicht ansprechen.
- Versetzung in einen Raum weitab von den Kollegen.
- Den Arbeitskolleginnen und -kollegen wird verboten,
den Betroffenen anzusprechen.
- Man wird wie „Luft“ behandelt.
3. Auswirkungen
auf das soziale Ansehen
- Hinter dem Rücken der Betroffenen wird schlecht
über sie gesprochen. — Man verbreitet Gerüchte.
- Man macht jemanden lächerlich.
- Man verdächtigt jemanden, psychisch krank zu sein.
- Man will jemanden zu einer psychiatrischen Untersuchung
zwingen.
- Man macht sich über eine Behinderung lustig.
- Man imitiert den Gang, die Stimme oder Gesten, um jemanden
lächerlich zu machen.
- Man greift die politische oder religiöse Einstellung
an.
- Man macht sich über das Privatleben lustig.
- Man macht sich über die Nationalität lustig.
- Man zwingt jemanden Arbeiten auszuführen, die
das Selbstbewußtsein verletzen.
- Man beurteilt den Arbeitseinsatz in falscher und kränkender
Weise.
- Man stellt die Entscheidungen der Betroffenen in Frage.
- Man ruft ihm obszöne Schimpfworte oder andere
entwürdigende Ausdrücke nach.
- Sexuelle Annäherungen oder verbale sexuelle Angebote.
4. Angriffe
auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation
- Man weist der Betroffenen keine Arbeitsaufgaben zu.
- Man nimmt ihr jede Beschäftigung am Arbeitsplatz,
so daß sie sich nicht einmal selbst Aufgaben ausdenken
kann.
- Man gibt ihr sinnlose Aufgaben.
- Man gibt ihr Aufgaben weit unter ihrem eigentlichen
Können.
- Man gibt ihr ständig neue Aufgaben.
- Man gibt ihr „kränkende“ Arbeitsaufgaben.
- Man gibt dem Betroffenen Arbeitsaufgaben, die seine
Qualifikation übersteigen, um ihn zu diskreditieren.
5. Angriffe
auf die Gesundheit
- Zwang zu gesundheitsschädlichen
Arbeiten.
- Androhung körperlicher Gewalt.
- Anwendung leichter Gewalt, zum Beispiel, um jemandem
einen „Denkzettel“ zu verpassen.
- Körperliche Mißhandlung.
- Man verursacht Kosten für den Betroffenen, um
ihm zu schaden.
- Man richtet physischen Schaden im Heim oder am Arbeitsplatz
des Betroffenen an.
- Sexuelle Handgreiflichkeiten.

|
