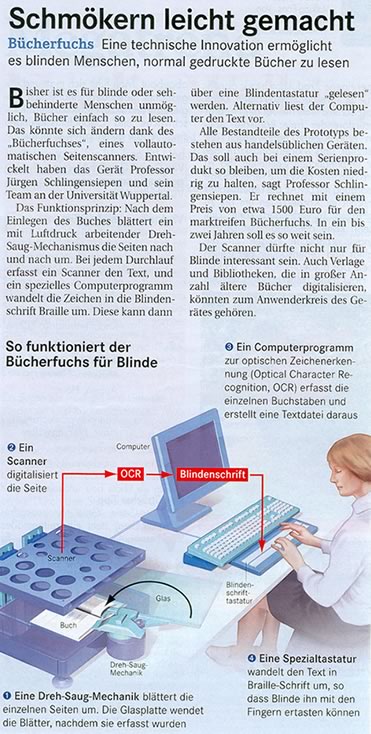
in:
Apotheken Umschau, 15. Mai 2005 B, S. 50
 Neue Sehhilfe für Farbenblinde
Neue Sehhilfe für Farbenblinde
Menschen mit Farbfehlsichtigkeit können
mit einer neuartigen Korrekturbrille Farben problemlos unterscheiden.
In einer ersten Studie ermöglichte es die Sehhilfe
allen rund 40 Teilnehmern, die gängigen und für
Polizisten oder Piloten obligatorischen Farbtests erstmals
zu bestehen.
Weltweit leiden rund 180 Millionen Menschen
an Farbfehlsichtigkeit. Die Störung beruht auf einem
genetischen Defekt, der hauptsächlich bei Männern
auftritt. Um die Sehschwäche zu lindern, muss der individuelle
Grad der Störung im gesamten sichtbaren Farbbereich
exakt bestimmt werden. Ein Physiker der Universität
Göttingen entwickelte nun einen computergestützten
Sehtest, der auf einem neuen Farbmodell basiert. Damit kann
der Grad der Fehlsichtigkeit sehr präzise bestimmt
werden. Auf dieser Basis entwickelte der Forscher eine aus
gängigen Filtermaterialien zusammengestellte Farbkorrektursehhilfe.
Der Pysiker hat nach eigenen Angaben bereits
mehrere hundert Bestellungen für die Sehhilfe vorliegen.
Bis zur Serienreife ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zunächst
wird nun der rennomierte Tübinger Netzhaut-Spezialist
Profesor Eberhard Zrenner die Wirksamkeit des Verfahrens
in medizinischen Tests untersuchen.
in: Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe
Nr. 14, 9./10. April 2005, S. 3
 Neues Medikament bei drohender Erblindung
durch Makula-Degeneration
Neues Medikament bei drohender Erblindung
durch Makula-Degeneration
Die Eintrübung des Augennetzhaut-Zentrums
ist zu stoppen
Ein neuartiges Medikament verspricht nach
Einschätzung von Augenchirurgen Hilfe bei drohender
Altersblindheit. Das Präparat (Macugen) stoppe in den
meisten Fälle die Eintrübung des Augennetzhaut-Zentrums,
die so genannte Makula-Degeneration. Das berichtete der
Präsident Deutscher Ophthalmochirurgen (DOC), Armin
Scharrer, im Zusammenhang mit einem in Nürnberg organisierten
Fachkongress von Experten der Augenheilkunde.

Augen-Blick: Regelmäßige Untersuchung
der Augen ist schon in jüngeren Jahren kein Fehler.
Im Alter ist das Risiko der Erblindung durch Makula-Degeneration
beachtlich. Von 70-Jährigen erkranken rund 15 Prozent
daran. (Foto: dpa)
Das Medikament werde im nächsten Jahr auf den Markt
kommen. Es werde in den hinteren Augenabschnitt des Patienten
eingespritzt. Dort verhindere es die unerwünschte Neubildung
minderwertiger Augengefäße, die zur Eintrübung
des Netzhaut-Zentrums führe. In klinischen Tests habe
sich bei 80 Prozent der Patienten die Sehleistung stabilisiert,
bei 26 Prozent habe sich damit sogar die Sehleistung verbessern
lassen. "Das ist die viel versprechendste Therapie
bei der Makula-Degeneration in den vergangenen 20 Jahren",
betonte der Augenchirurg.
Bisher habe es nur unzureichende Therapien gegen diese
Augenerkrankung gegeben, die meist bei älteren Patienten
zu einer raschen Erblindung führe. So habe man versucht,
mit einer Ernährungsumstellung der Patienten die unterernährte
Netzhaut mit mehr Vitaminen und Spurenelementen zu versorgen.
Auch sei die erkrankte Netzhautmitte mit Laser behandelt
worden. Allerdings konnte laut Scharrer damit nur vergleichsweise
wenigen Patienten geholfen werden. Das werde sich jetzt
ändern, schätzt der niedergelassene Mediziner.
Unter der Makula-Degeneration leiden nach Angaben Scharrers
rund 15 Prozent aller über 70-jährigen Männer
und Frauen in den westlichen Industriestaaten. Meist seien
die Zellen der Netzhautmitte, der Stelle des schärfsten
Sehens, unterernährt. Als Reaktion darauf bildeten
sich dort neue minderwertige Zellen. Von den zwei Arten
der Makula-Degeneration - der trockenen und der feuchten
Variante - sei die feuchte die gefährliche, da sie
über kurz oder lang zur Erblindung führe.
Dieter P. Ahlers, in: Badische Neueste Nachrichten,
Ausg. Nr. 29, 17.7.2004, S. 3
 Der Visor - Visuelle Zeitenwende für
Sehgeschädigte
Der Visor - Visuelle Zeitenwende für
Sehgeschädigte
Das Funktionsprinzip des Visors beruht auf
dem Orientierungssystem Ultraschall, das in der Natur bei
Fledermäusen, Meeressäugern sowie bestimmten Schlangen-
und Insektenarten entdeckt wurde. Tiere nehmen ihre Umgebung
wahr, ohne auf optische oder akustische Reize angewiesen
zu sein.
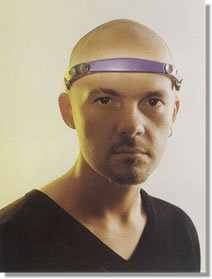
Elegant und wirksam - der "Visor" ergänzt
den Blindenhund
Sehgeschädigte Menschen setzen den Visor
als Orientierungshilfe auf die Stirn auf. Eingebaute Ultraschallsender
und -empfänger ermitteln Hindernisse. Ein Mikroprozessor
errechnet die Positionen, kleine Kunststoffstifte tippen
die Meldungen mit leichtem Druck auf die Stirn des Benutzers.
Durch die horizontale Anordnung der Stifte kann die Richtung
des jeweiligen Hindernisses angegeben werden. Die Taktfrequenz
zeigt die Entfernung zum Objekt an.
Die taktile Meldung ermöglicht dem Visor-Träger
eine volle Konzentration auf die Geräuschkulisse seiner
Umgebung. Andererseits muss die Meldung nicht unbedingt
über taktile Signale erfolgen. Durch einfaches Umschalten
kann sie dem Benutzer auch akustisch dargeboten werden.
Der Visor ergänzt den Langstock und wird
in Innenräumen sogar zum essentiellen Orientierungsmittel,
da der Langstock dort nicht sinnvoll einzusetzen ist.
(Allmendinger, G., Visuelle Zeitenwende.
Körber-Stiftung (Hrsg.), 1996/97, 37)
 Computergestützte Heimtherapie an Kindern
- Visusstimulation mit sinusoidal moduliert oszillierenden
Gittern unter patientenadaptiver Aufmerksamkeitsbindung.
Computergestützte Heimtherapie an Kindern
- Visusstimulation mit sinusoidal moduliert oszillierenden
Gittern unter patientenadaptiver Aufmerksamkeitsbindung.
Bis zu 6,5% aller Kinder leiden an Amblyopie,
bei der die Sehkraft des einen Auges durch das andere unterdrückt
wird. Diese Sehstörung ist meist mit Schielen verbunden.
Die Schielstellung kann operativ beseitigt werden, doch
die Amblyopie bleibt. Das Auge, die "Hardware"
des Sehens, ist dann zwar intakt, aber die Störungen
werden durch die "Software" zur Verarbeitung der
Reize im Gehirn verursacht. Im Kindesalter, bei noch ausreichend
plastischem Nervensystem, besteht die Chance, der Störung
durch Sehschulung aktiv entgegenzuwirken. Die traditionelle
Therapiemethode der Occlusion, bei der das starke Auge abgeklebt
und das schwache zum Sehen gezwungen wird, birgt medizinische
und psychosoziale Gefahren.
Bei der Methode der computergestützten
Sehschulung betrachten die Kinder ausgewählte Reizmuster,
zum Beispiel dynamische gitterartige oder konzentrische
Wellen einer Hell-Dunkelabstufung, von bestimmter räumlicher
und zeitlicher Frequenz.

Ein Computerspiel, vor dem Kinder ausnahmsweise einmal
gar nicht lange genug sitzen können, verspricht es
doch erhebliche Therapieerfolge.
Auf der Basis-Software aufbauend, wurden Programme
ausgearbeitet, bei denen die Stimulation in eine Computerspielsituation
(Autorennen oder Flugsimulation) eingebettet ist, wodurch
die Aufmerksamkeit der jungen Patienten auch über längere
Zeiträume erhalten bleibt. In einer Pilotserie wurden
die Programme an neun Kindern im Alter von sechs bis zwölf
Jahren getestet. Nach zweiwöchiger Behandlung zeigten
sich bereits beachtliche Erfolge, vor allem eine kontinuierliche
Verbesserung beim Nahsehen, was weitere Fortschritte bei
einer längeren Behandlung erhoffen lässt.
(Kurze, U., Ludwig, D.: Visuelle Zeitenwende.
Körber-Stiftung (Hrsg.), 1996/97, 11)
Diese Seite wird fortlaufend
aktualisiert. Es lohnt sich also, wieder einmal vorbeizuschauen!

|
