Der Vorname "Hadumoth" ist
in unserer Zeit in Vergessenheit geraten, und daher werde
ich immer wieder gefragt, woher dieser Name kommt. So ist
es für mich besonders reizvoll, an dieser Stelle hierzu
einige Erläuterungen zu geben.
Übersicht:
1. Hadumod
— Äbtissin von Gandersheim
2. Hadumoth in v. Scheffels
Roman "Ekkehard"
2.1 Der Roman "Ekkehard"
2.2 Theateraufführung "Audifax
und Hadumoth" sowie Verfilmung des
Romans "Ekkehard"
2.3 Scheffel und der Hohentwiel
2.4 Das Oratorium
"Hadumoth" von Le Beau
2.5 Vorkommen des Namens
"Hadumoth" in der Bodenseegegend
3. Trägerinnen des Namens
"Hadumoth" und "Hadumod"
4. Weitere Ergebnisse meiner
Recherche
5. Literaturliste
Bei "Hadumoth"
handelt es sich um einen alten deutschen weiblichen Vornamen,
auch in den Formen "Hadumod", "Hadmut"
und "Hadmute", wobei ahd. hadu 'Kampf'
und ahd. muot 'Sinn, Gemüt, Geist' bedeuten.
Hervorzuheben sind zum einen Hadumod
(Hathumoda), die Äbtissin von Gandersheim, und zum
anderen die Hadumoth in Joseph Victor von Scheffels Roman
"Ekkehard".
1. Hadumod — Äbtissin von Gandersheim
Zur "Hadumod" gibt das 'Biographisch-Bibliographische
Kirchenlexikon', Bd. XV (1999) Auskunft:
"HATHMODA: hl. (?) Äbtissin,
geb. um 840 in Sachsen, gest. 28.11.874 in Gandersheim.
– Die vielleicht als Heilige verehrte Benediktinerin
war die Tochter des Herzogs Liudolf von Sachsen und seiner
Frau Oda. Im Jahre 852 wurde sie Äbtissin des von
ihren Eltern gegründeten Klosters Brunshausen. Im
Jahre 856 wurde dieses Kloster nach Gandersheim verlegt.
Sie galt als regeltreue Ordensfrau. Berühmt war ihre
große Mütterlichkeit. Sie pflegte auch ihre
kranken Mitschwestern. Als einmal eine förmliche
Epidemie in ihrem Kloster ausbrach, bediente sie auch
die Kranken, infizierte sich selbst und starb. [...] –
Um das Jahr 875 verfaßte ihr Onkel, Agius von Corvey,
ihre Vita. Dieser Vita folgte aus derselben Feder der
‘Dialogus de obitu Hathumodae'."
Wie zusätzlich vermerkt, wird Hathumoda
bisweilen als Heilige bezeichnet, ein Kult ist nicht nachweisbar.
Friedrich Rückert übersetzt
1845 die Geschichte der Hadumod, der Gründerin und
Äbtissin des Klosters Gandersheim aus dem Lateinischen:
Agius <Corbeiensis>. Das Leben der Hadumod, Tochter
des Herzogs Liudolf von Sachsen: erster Äbtissin des
Klosters Gandersheim .../ beschrieben von ihrem Bruder Agius.
Der Originaltitel lautet "Vita Hathumodae".

Was die verwandtschaftliche Beziehung
zwischen Agius und Hathumoda anbelangt (Onkel bzw. Bruder),
so besteht in der wissenschaftlichen Literatur aufgrund
weiterer Untersuchungen inzwischen die Meinung, daß
aus der Anrede Hathumodas als 'soror' nicht auf eine leibliche
Verwandtschaft geschlossen werden darf, welche lange Zeit
auf Akzeptanz gestoßen war ( mehr).
mehr).
Im Jahr 1888 erscheint die Übersetzung
von Georg Grandaur "Leben des Abtes Eigil von Fulda
und der Äbtissin Hathumoda von Gandersheim nebst der
Übertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus".

2. Hadumoth in v. Scheffels Roman "Ekkehard"
 2.1 Der Roman "Ekkehard"
2.1 Der Roman "Ekkehard"
Meine Namensgebung im Jahr 1949 geht
auf den Roman "Ekkehard" (1855) des badischen
Dichters Joseph Victor von Scheffel (16.2.1826 - 9.4.1886)
zurück. Aus meiner Kindheit ist mir ein Besuch der
Theateraufführung "Audifax und Hadumoth"
im Badischen Staatstheater Karlsruhe in Erinnerung geblieben
(siehe  Kap. 2.2), ebenso die Ausflüge in
damaliger Zeit in Begleitung meiner Mutter in den Stadtgarten
Karlsruhe zu "Hadumoth und Audifax". Diese beiden
Plastiken sind auch heute dort noch vorhanden, wenn auch
an einem anderen Platz.
Kap. 2.2), ebenso die Ausflüge in
damaliger Zeit in Begleitung meiner Mutter in den Stadtgarten
Karlsruhe zu "Hadumoth und Audifax". Diese beiden
Plastiken sind auch heute dort noch vorhanden, wenn auch
an einem anderen Platz.

Hadumoth und Audifax vereint (Foto: Holzmann)
Hadumoth und Audifax im Stadtgarten vereint
Eingebettet in dichte Efeuranken, haben die beiden Hirtenkinder
"Hadumoth" (links) und "Audifax" (rechts)
unter einer Buche im Stadtgarten jetzt einen neuen Platz
gefunden. Die beiden Bronze-Figuren, die bis vor kurzem
noch getrennt aufgestellt waren, sind nach ihrer Renovierung
durch den Karlsruher Bildhauer Gerhard Karl Huber an dem
gemeinsamen Standort, nur wenige Meter vom Stadtgarten-Eingang
an der Ettlinger Straße entfernt, nun wieder vereint.
Im Rahmen der Instandsetzung bekam der Flötenspieler
"Audifax" Ersatz für einen abgeschlagenen
Finger, und das Mädchen "Hadumoth" kann
stolz auf eine neue Schaufel in seiner Hand blicken. Schußlöcher
durch Kriegseinwirkungen wurden ebenfalls fachmännisch
ausgebessert. Die Hirtenkinder "Hadumoth" und
"Audifax", Hauptfiguren aus Victor von Scheffels
Roman "Ekkehard", sind mit die ältesten
der insgesamt rund 40 Figuren, die der Stadtgarten beheimatet.
"Hadumoth" entstand 1902 durch den Bildhauer
Johann Heinrich Weltring, "Audifax" ist ein
1908 geschaffenes Werk von Christian Elsaesser, der an
der Karlsruher Akademie für Bildende Künste
lehrte.
(aus BNN, 08/1984)
Weitere Artikel in Badische Neueste Nachrichten
(BNN) über Audifax und Hadumoth im Stadtgarten Karlsruhe
finden Sie  hier.
hier.
 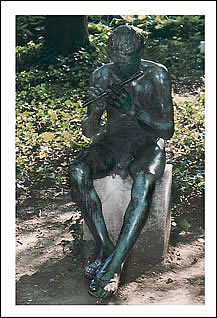
 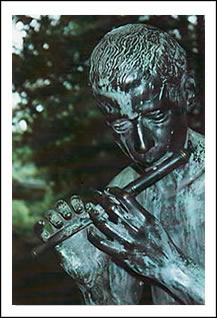
Hadumoth und Audifax (Fotos: H. Scholpp)
Wie Amadeus Siebenpunkt in seinem Buch
"Deutschland deine Badener" erzählt, war
Joseph Victor von Scheffel, den er im Zusammenhang mit den
"badischen Größen" Johann Peter Hebel
und dem Maler Hans Thoma nennt, Ende des 19. Jahrhunderts
neben Bismarck der wohl populärste Deutsche. Anläßlich
seines fünfzigsten Geburtstags wurde er vom Großherzog
geadelt, und man rühmte ihn als den größten
deutschen Dichter. Es galt als eine Schande, seinen "Ekkehard"
nicht gelesen zu haben. Auch zählte dieser Roman längere
Zeit zur Schullektüre.
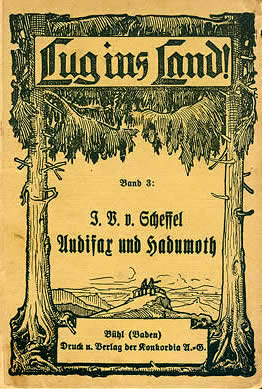
Seyfarth,
Friedrich: Audifax und Hadumoth: eine Geschichte zweier
Kinder aus der Zeit der großen Ungarnnot / nach
V. v. Scheffels Roman "Ekkehard" erzählt
von Fr. Seyfarth. Bühl (Baden): Konkordia 1954,
Ill
Wie ein Bericht der Universität
Friburg erläutert ( mehr), erlebte der Roman "Ekkehard" nach zögerlichen
Anfängen nach dem Deutsch-Französischen Krieg
von 1870 eine stürmische Verbreitung und wurde zum
Lieblingsbuch des deutschen Bürgertums mit der Überzeugung,
dieser Roman werde für alle Zeiten zur Weltliteratur
gehören.
mehr), erlebte der Roman "Ekkehard" nach zögerlichen
Anfängen nach dem Deutsch-Französischen Krieg
von 1870 eine stürmische Verbreitung und wurde zum
Lieblingsbuch des deutschen Bürgertums mit der Überzeugung,
dieser Roman werde für alle Zeiten zur Weltliteratur
gehören.
Den Hintergrund des Romans "Ekkehard"
bildet die frühe Welt des Mittelalters, in der das
Christentum bei den deutschen Stämmen Eingang gefunden
hatte, und der große Hunnensturm aus dem Osten den
Süden Deutschlands bedrohte.
Ekkehard, ein Mönch des Klosters
St. Gallen, wird von der schwäbischen Herzoginwitwe
Hadwig als Privatlehrer für Latein auf die Burg Hohentwiel
geholt (der Hohentwiel ist einer der Vulkanberge des Hegau
in Oberschwaben).
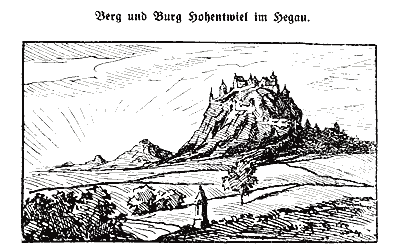
Bildschmuck von Oberzeichenlehrer Fr.
Greiner, Freiburg. In: Seyfarth, Friedrich:
Audifax und Hadumoth: eine Geschichte zweier
Kinder aus der Zeit der großen Ungarnnot / nach
V. v. Scheffels Roman "Ekkehard" erzählt
von Fr. Seyfarth. Bühl (Baden): Konkordia 1954,
Ill
Er verliebt sich in die schöne Herzogin,
erklärt sich dieser aber erst nach einer Zeit der Trennung
aufgrund des Kampfes gegen die Hunnen. Doch Hadwigs Zuneigung
ist wegen seiner verspäteten Liebeserklärung einer
Kränkung gewichen, und sie weist ihn zurück. So
zieht Ekkehard sich aus verschmähter Liebe in die Bergeinsamkeit
zurück und schreibt dort das berühmte "Walthari-Lied".
Bei einem letzten Besuch auf dem Hohentwiel läßt
er der Herzogin sein Werk zukommen und zieht unerkannt von
dannen.
Hadumoth und Audifax sind Hirtenkinder
im Dienste der Herzogin. In der Zeit des Hunneneinfalls
wird Audifax verschleppt, und Hadumoth zieht den Rhein hinauf
und befreit Audifax aus dem Hunnenlager. Nach der Rückkehr
zur Herzogin hebt diese die Leibeigenschaft der beiden auf
und gewährt ihnen die Freiheit. Audifax, welcher einen
großen Goldschatz aus dem Hunnenlager mitgebracht
hat, lernt die Goldschmiedekunst und zieht nach Konstanz.
Er heiratet seine Gefährtin Hadumoth, die Herzogin
wird Taufpatin des ersten Sohnes.

"Audifax und Hadumoth"
Nach einem Gemälde von M. Wunsch, 1899
Eine nette Darstellung der beiden Hirtenkinder
als Scherenschnitt findet sich in dem Buch "Willst
du nicht das Lämmlein hüten..." von Irmingard
von Freyberg (Würzburg: Naumann, 1981).

"Auf der Burg Hohentwiel im Hegau
gab es zwei Hirtenkinder, Audifax und Hadumoth, von denen
Victor von Scheffel im 'Ekkehard' berichtet. Die Kinder
glaubten an einen verborgenen Schatz, nach dem sie ruhelos
suchten, bis sie von den heranbrausenden Hunnen entdeckt
und verschleppt wurden. Später aber kehrten sie auf
die Burg zurück und lebten als glückliches Paar."
(Freyberg, Irmingard von: Willst du nicht das Lämmlein
hüten..., Würzburg: Naumann, 1981)

 2.2 Theateraufführung "Audifax und Hadumoth"
sowie Verfilmung des
2.2 Theateraufführung "Audifax und Hadumoth"
sowie Verfilmung des
Romans "Ekkehard"
Von der Jugendbühne des Karlsruher
Staatstheaters wurde in der Spielzeit 1953/54 das von der
Karlsruher Schriftstellerin Lola Ervig nach Scheffels Roman
„Ekkehard“ geschriebene Stück „Audifax
und Hadumoth“ uraufgeführt.
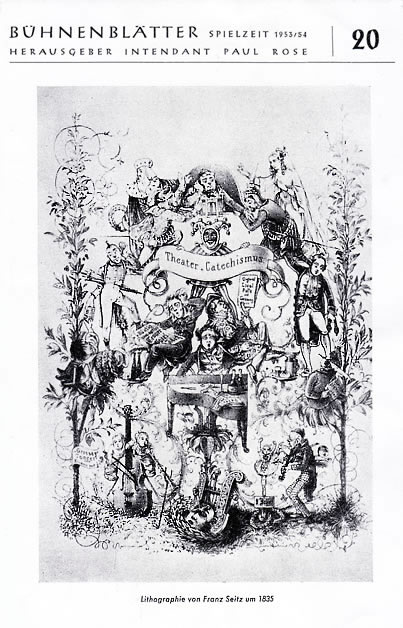
Lithographie von Franz Seitz um 1835
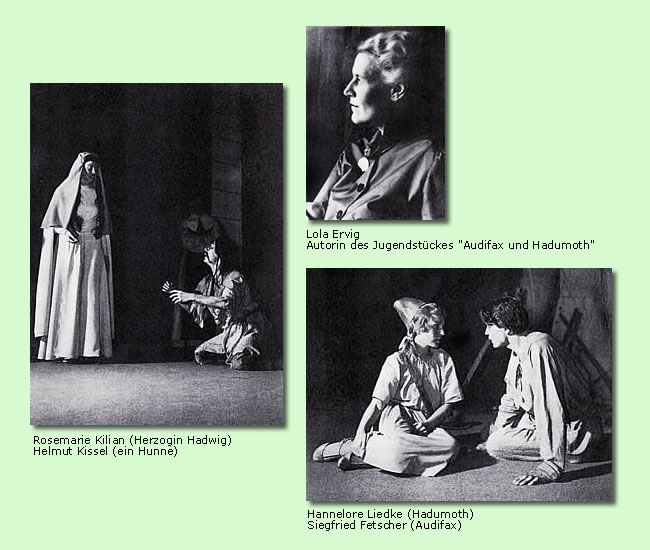
Mein Dank gilt dem Mitarbeiter des Archivs
des Badischen Staatstheaters Karsruhe.
 Pressestimmen zur Theater-Uraufführung
Pressestimmen zur Theater-Uraufführung
Die Verfilmung des Romans fand anlässlich
des tausendsten Todesjahres von Ekkehard (gest. 990) statt.
Laut Bericht der Universität Friburg (s. o.) läßt
dieser Mittelalter-Film ebenso wie die Verfilmung von Umberto
Ecos Roman "Der Name der Rose" Millionen von Zuschauern
das 'Mittelalter' hautnah erleben. Die deutsch-ungarische
Historienserie "Ekkehard" lief 1989 im Deutschen
Fernsehen im ARD und wurde dort als Spielfilm 1990 wiederholt
( mehr).
mehr).

 2.3 Scheffel und der Hohentwiel
2.3 Scheffel und der Hohentwiel
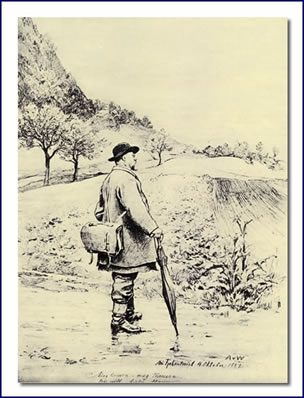
Am Hohentwiel: Scheffel, den Hegau durchschreitend (Zeichnung:
A. v. Werner)
aus: Bader, W.: Auf Scheffels Spuren am Untersee - Zur 50.
Jährung des Todestages
des Dichters am 9. April, Zeitschrift unbekannt, Heft 16/1936,
S. 365
Mehr über Victor v. Scheffel und
den Hohentwiel finden Sie  hier.
hier.

 2.4 Das Oratorium "Hadumoth" von Le Beau
2.4 Das Oratorium "Hadumoth" von Le Beau
Unter den Werken von Luise Adolpha Le
Beau (1850-1927), einer badischen Komponistin, welche 1874
von Karlsruhe nach München kam, um ihre musikalische
Ausbildung fortzusetzen, befindet sich auch die Partitur
ihres op. 40 – Hadumoth, Szenen aus Scheffels
"Ekkehard" für Soli, Chor und Orchester.

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)
Le Beau, welche zuvor einen Sommer lang
in Baden-Baden bei Clara Schumann zur Konzertpianistin ausgebildet
wurde (davor bei Kalliwoda in Karlsruhe), studierte in München
als erste Frau überhaupt – wenn auch separat
unterrichtet – bei Joseph Rheinberger Kompositionstechnik.
In München gründete sie zudem ein kleines Musikinstitut
und war eine beliebte Pädagogin.
Mit dem Oratorium "Hadumoth"
begann Le Beau 1890 in Berlin, wo sie deshalb nur noch einem
kleinen Teil von Schülerinnen musikalischen Unterricht
gab. In Baden-Baden fand am 19. November 1894 die Uraufführung
von „Hadumoth“ statt (nachdem die Großherzogin
Luise bereits die Generalprobe besucht hatte) und wurde
ein großer Erfolg.
Eine enthusiastische Rezension über
Le Beaus "Hadumoth" findet sich u. a. im Badener
Badeblatt vom 23. 11. 1894, jedoch ging "Hadumoth"
nicht in Druck. Eine weitere erfolgreiche Aufführung
erlebte "Hadumoth" noch in Konstanz 1894 (siehe
auch: Spaude/Lit.verz. sowie  www.le-beau.de).
www.le-beau.de).

 2.5 Vorkommen des Namens "Hadumoth" in der Bodenseegegend
2.5 Vorkommen des Namens "Hadumoth" in der Bodenseegegend
Einen Bekanntheitsgrad hat der Name heute
noch in Singen am Hohentwiel und in der Gegend am Bodensee.
So gibt es sowohl in Singen als auch in Radolfzell und Konstanz
eine Hadumoth-Straße.

Foto:
H.R. Scholpp
Sogar Schiffe haben den
Namen "Hadumoth" bekommen. Auf dem Bodensee nimmt
"Hadumoth IV", eine schöne alte Yacht und
Schwesternschiff von "Audifax", noch an Segelregatten
teil. Es handelt sich dabei um einen Schärenkreuzer,
1912 gebaut und von Herrn Magirus erworben. Im Herbst 2004
annonciert die Yachtwerft Martin in Radolfszell "Hadumoth
privat zu verkaufen", eine restaurierte, luxuriöse
Segelyacht mit dem Baujahr 1948/49.
Siehe auch:
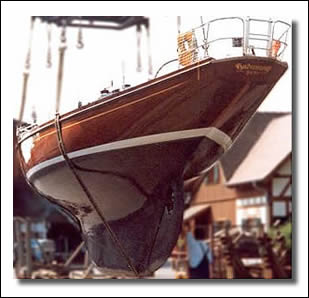
 
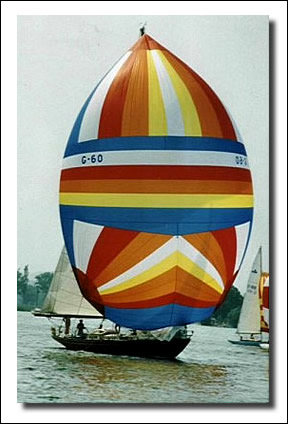
Im Jahr 1999 wurde von
Erich Georg Gagesch in einem Singener Verlag ein Buch veröffentlicht
mit dem Titel "Audifax und Hadumoth". Dieses als
Kinderbuch konzipierte Buch gewährt einen spannenden
Einblick in den historischen Roman "Ekkehard"
von Joseph Victor von Scheffel; Orte des Geschehens sind
Hegau, Hohentwiel und Bodensee.
Dieses Buch ist auch mit Aquarellen und
Skizzen ausgestattet, wie sich auch in zahlreichen Ausgaben
vom "Ekkehard" oder zum Roman schmückende
Abbildungen befinden. Als Beispiel sei hier die folgende
Künstlergraphik "Audifax und Hadumoth" genannt:
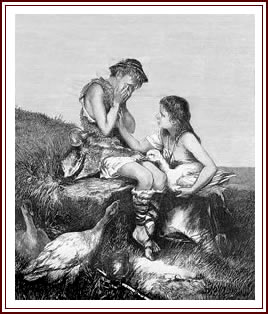
"Audifax
und Hadumoth". Nach der Komposition von F. Flüggen
aus dem Bilderzyklus zu Victor v. Scheffel’s "Ekkehard"
(München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft).
Es handelt sich dabei um einen Original Holzstich aus
dem Jahre 1886.

3. Trägerinnen des Namens "Hadumoth"
und "Hadumod"
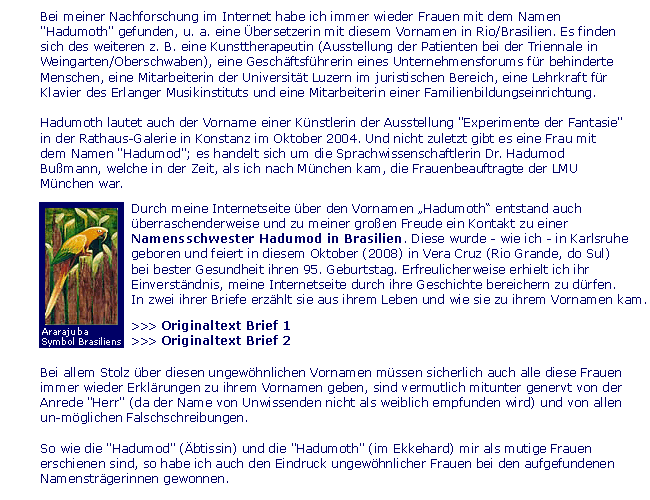

4. Weitere Ergebnisse meiner Recherche
Zur Abrundung meiner Erklärungen
möchte ich noch einige "Extras" zum Namen
"Hadumoth" aufführen:
- Auf der Liste eines Immigrantenschiffs, der SS Skaugum,
befindet sich eine Passagierin namens Hadumoth Cimesa.
Dieses Schiff fuhr am 2. Mai 1949 von Neapel nach Melbourne
und kam dort am 31. Mai 1949 an (
 mehr).
mehr).
- "Hadumoth" war der Titel eines Freilichtfestspiels
(1949) des Geistlichen Rates und Dekans Dr. Otto Menzinger
auf der Burg Lichtenegg. Es handelt sich dabei nicht um
Scheffels "Hadumoth" im Ekkehard, sondern diese
"Hadumoth" wurde nach einer Bayerwaldsaga geschrieben.
Zugrunde liegt der nicht belegte, aber denkbare Besuch
des Minnesängers Wolfram von Eschenbach auf Lichtenegg
bei der von ihm verehrten Markgräfin Elisabeth vom
Haidstein (
 mehr).
mehr).
- Schließlich bin ich bei
meiner Recherche auf eine Liste von über 50.000 Dahliensorten
von Gerry Weyland gestoßen und habe darunter eine
Dahliensorte namens "Hadumoth" aus dem Jahr
1954 entdeckt (
 mehr).
mehr).

5. Literaturliste
Auch die Literaturliste zeigt,
daß der Name "Hadumod" bzw. "Hadumoth",
obwohl er derzeit in Vergessenheit geraten ist, mit Leben
gefüllt ist (Trägerinnen des Namens "Hadumoth"
als auch Veröffentlichungen mit/zu diesem Namen finden
sich naturgemäß häufiger zu der Zeit,
als Scheffels Roman noch nachwirkte).
Agius, Mönch in
Corvey, lateinischer Dichter des 9. Jahrhunderts. —
A. verfaßte um 876 eine Vita der um 874 verstorbenen
Hathumod, der ersten Äbtissin von Gandersheim, Tochter
des Herzogs Liudolf von Sachsen, und eine ihr gewidmete
Totenklage in 359 Distischen in Dialogform: Vita und obitus
Hathumodae u. Dialogus, hrsg. v. Georg Heinrich Perte. in:
MG SS IV, 165 ff.: übers. v. Rückert, Friedrich,
1845 (Angabe laut Biographisch-Bibliographischem Kirchenlexikon,
Bd. 1 (1990), Sp. 55 Autor: Bautz, Friedrich Wilhelm) (siehe
auch: Rückert, Friedrich, 1845).
Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon, Bd. XV: Hathumoda: Spalte 692-693.
Nordhausen: Bautz 1999.
Bußmann, Hadumod (Hrsg.):
Lexikon der Sprachwissenschaft. 3., akualis. u. erw. Aufl..
Stuttgart: Kröner 2002.
Bußmann, Hadumod:
Das Genus, die Grammatik und — der Mensch: Geschlechterdifferenz
in der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner 1995.
(sowie weitere Schriften zur Genderforschung)
Dieterich, Hadumoth:
Über jugendliche Pseudolinguisten. o. O. Bonn, Med.
F. Diss. [1948].
Gagesch, Erich Georg:
Audifax und Hadumoth. Nach dem Roman Ekkehard von Joseph
Victor von Scheffel. Singen am Hohentwiel: Kalliope-Verl.
1999.
Gans, Hadumoth C.: Dt.
Übersetz. und Zusfass. aus dem Brasilian. von: Medeiros,
Laudelino T., Lenhard, Rudolf: Schulbildung im ländlichen
Gebiet von Santa Cruz do Sul. Dortmund: Sozial.forschungsstelle
der Univ. Münster, 1970.
Grandaur, Georg: Leben
des Abtes Eigil von Fulda und der Äbtissin Hathumoda
von Gandersehein nebst der Übertragung des hl. Liborius
und des hl. Vitus/ übers. von Georg Grandaur. Leipzig:
Verlag der Dyk´schen Buchhandlung 1888. — 1.
repr. New York: Johnson 1970.
Hankel, Hadumoth: Narrendarstellungen
im Spätmittelalter. Freiburg i. Br., Univ., Diss.,
1952.
Heinsius, Maria: Mütter
der Kirche in deutscher Frühzeit. Potsdam: Stiftungsverlag,
o. J. (Beiträge über Radegunde, Lioba, Hathomod
v. Gandersheim, ...)
Keil, Ulrike Brigitte:
Das Hirtenmädchen Hadumoth — Ein Oratorium nach
Szenen aus Joseph Victor von Scheffels "Ekkehard",
komponiert von Luise Adolpha Le Beau. In: Jahrbuch —
Musik in Baden-Würtemberg, Bd. 4, hrsg. v. Günther,
Georg u. Nägele, Reiner, Stuttgart: Metzler 1997.
Kessler, Curt: Hadumoth. Fabelo
el Mezepeko: Originale verkita de Curt Kessler.
Dresdenaj kajeretoj 4 (Dresdner Heftchen 4 in Esperanto).
Dresden 1958. (Germana Esperanto — Biblioteko en Aaalen)
Kommerell, Hadumoth:
Über die Zuverlässigkeit tonographischer Messungen.
Tübingen, Univ., Diss., 1958.
Kraze, Friede H.: Die
schöne und wunderbare Jugend der Hadumoth Siebenstern.
Stuttgart: Thienemann 1920.
Le Beau, Luise Adolpha:
Hadumoth. Scenen aus Scheffel’s Ekkehard; zsgest.
von d. Componistin; gedichtet v. Luise Hitz; für Soli,
Chor und Orchester; op. 40. Partitur. Baden-Baden, 1894.
Le Beau, Luise, Adolpha:
Hegauer Tanz und Chor aus Hadumoth. Scenen aus Scheffel’s
Ekkehard; für Soli, Chor und Orchester; op. 40. Für
Klavier allein gesetzt von d. Komponistin. Baden-Baden.
Menzinger, Otto: Hadumoth
(Freilichtfestspiel, Burg Lichtenegg). Uraufführung
1949.
Rückert, Friedrich:
Das Leben der Hadumod, Tochter des Herzogs Liudolf von Sachsen:
erster Äbtissin des Klosters Gandersheim ... /beschrieben
von ihrem Bruder Agius ... Aus dem Latein übertr. von
Friedrich Rückert. Stuttgart: Liesching 1845.
Sauser, Ekkart: Hathumoda.
In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. XV,
Spalte 692-693. Nordhausen: Bautz 1999.
Scheffel, Joseph Victor von:
Ekkehard: Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.
Frankfurt a. M.: Meidinger (= Deutsche Bibliothek 7) 1855
(Erstdruck). (Darin enthalten ist die Geschichte von Audifax
und Hadumoth.)
Scheffel, Joseph Victor von:
Ekkehard — Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert,
illustriert von J. Wildschau. Leipzig: Johannes M. Meulenhoff
1919, 12.-30. Tausend.
Scheffel, Joseph Victor von:
Ekkehard. Ein historischer Roman. Wiesbaden: Vollmer, o.
J. (Diese Beipiele sollen genügen für die große
Anzahl verschiedener Ausgaben.)
Scholpp, Hadumoth Radegundis:
Das Sehen als Medium menschlicher Bildungsprozesse. Eine
Untersuchung zu pädagogischen, didaktischen und therapeutischen
Dimensionen des Sehens mit Schwerpunkt im elementaren Bildungsbereich.
Diss. München, Univ., 2001. München: Utz 2004.
Seyfarth, Friedrich: Audifax
und Hadumoth: eine Geschichte zweier Kinder aus der Zeit
der großen Ungarnnot / nach V. v. Scheffels Roman
„Ekkehard“ erzählt von Fr. Seyfarth. Bühl
(Baden): Konkordia 1954, Ill.
Siebenpunkt, Amadeus:
Deutschland deine Badener. Gruppenbild einer verzwickten
Familie. Hamburg: Hoffmann und Campe 1975.
Spaude, Edelgard: "Weibliches
Empfinden und männliche Stärke". Luise Adolpha
Le Beau (1850-1927). In dies.: Eigenwillige Frauen in Baden.
Freiburg i. Br.: Rombach 1999, S. 115-139.
Zoepf, Ludwig: Lioba;
Hathumoda, Wiborada. München 1915, S. 37-61


|