|
|
Über
den Eilfinger Berg stiegen wir in einer milden Sonne zum See
hinab, zwischen den Rebstöcken, in einiger Sorge, daß
Regen und Sonne an den Trauben noch ihr gutes Werk tun.
In
dieser Ecke Württembergs, die zum nördlichen Schwarzwald
guckt und in den badischen Kraichgau ihre Hügel laufen
läßt, nach Bretten und Bruchsal, begegnen sich
seltsame Geister. Sie ist dem eigentlichen Weinland schon
etwas entrückt; aber mit einer letzten Anstrengung haben
es die schwäbischen Weine hier erreicht, „flaschenreif“
zu werden und ihre Spitze zu finden. [...] Da ist das Kloster,
und es gibt keine schönere Klosteranlage als diese in
ganz Deutschland, oder doch keine, der Mittelalter und spätere
Zeitläufe der Geschichte so lebendig und treu bleiben,
ohne zum Museum zu erstarren. Maulbronn, das die Zisterzienser
nach ihrer Art in ein abgelegenes, wasserreiches Tal gestellt
hatten, blieb immer im Fluß der Geschichte. Hier war
der Nekromant und Zauberer Johannes Faust, ein Sohn des benachbarten
Ackerstädtchens Knittlingen, der Gast der Mönche;
hier, in diesen Stuben, saß der junge Kepler über
den Schulbüchern; hier, unter diesen Linden, die uralt
und mächtig ihre Kronen in die Höhe und Weite dehnen,
träumte wohl Hölderlin zu der Musik des nie ermüdenden
Brunnens – die erste Liebe band damals das Herz des
Knaben.
Als
die Mönche, unter Speyers Schirm, ihr Werk begannen,
den Wald rodeten, die Seen stauten, erstellten sie eine große
Basilika, in hellem Sandstein; den brachen sie aus der dicht
anstehenden Talwand und fügten ihn in schöne glatte
Quadern. Die großen Maße eines strengen, kubischen
Empfindens bestimmten den romanischen Baukörper; die
später eingezogene gotische Decke nimmt der Wandung nichts
von ihrer einfachen Wucht. Aber nun kommt, als der Bruder
Bohnensack vor die Hauptpforte einen Vorraum, das Paradies,
aufzurichten beginnt, ein Anhauch aus dem Westen durch das
geöffnete Tal, wohl vom Burgundischen her. Die Steine
wollen sich lockern, die Säulen sich strecken, die Wölbungen
freier sein, der Raum wird zur Halle.
Fast
glaubt man zu spüren, wie der bauende Bruder etwas erschrocken
ist über sein Unterfangen, er gibt den Säulen eine
Zwischenbasis, er sorgt für Sockel und Gesimse –
aber das Neue ist da, ist hier, ist im Südteil des Kreuzganges,
ist in dem hochgetriebenen Herrenrefektorium, wo man mit vorsichtigen,
seltsamen Wülsten, mit Stützen und Konsolen noch
an die Schwere des Steines geklammert scheint und doch alles
Raumempfinden schon von der Gotik gesegnet ist. Die Kunstgelehrten
haben darüber viel geschrieben, die Architekten mit ihren
Zusatzbemerkungen und statischen Überlegungen nicht gespart
– das hat uns in diesen Tagen nicht sehr bewegt.
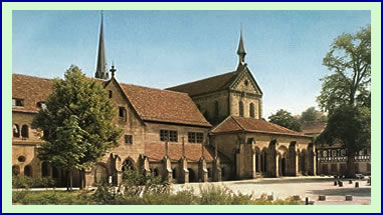
Doch
dem blieb im Wandern durch den Kreuzgang das Empfinden immer
geöffnet: wie es etwas Wunderbares ist, wenn jeder Schritt
fast in eine neue Darstellung sich entfaltender Seele tritt.
Dieser Kreuzgang ist ganz und gar nicht stilrein; er kann
als Fibel der Stilgeschichte dienen und steht als solche bei
den Professoren der umliegenden Hochschulen in großer
Schätzung; doch gibt es nichts, das so rührend und
erschütternd und beruhigend in einem ist, wie die fromme
Einheitlichkeit, die sich aus tastendem Mühen der Schwere
zu einer graziösen und fast eleganten Leichtigkeit, von
der Säule zum schlanken Stab, vom Rundbogen zum dünnen
Maßwerk entwickelt.
Die
Regel der Mönchszeit hat dem Bauwerk seine Räume
und seine Gliederung gegeben, Refektorium, Kapitelsaal, Wandelhalle,
gab ihm auch seine Anekdoten, den einzigen kleinen heizbaren
Erholungsraum in der riesigen Anlage – die Kirche bewahrt
die Erinnerungen blühenden handwerklichen Könnens:
Gestühl, dessen Wangen mit köstlich unbefangenen
Novellen der Bibel und des Weinbaus geschnitzt sind, einen
gewaltigen gotischen Kruzifixus aus Stein, Ende des 15. Jahrhunderts,
das Werk eines Steinmetzen, dessen Nachfahren noch heute in
der Gegend Steinmetzen sind. Als die Württemberger Herzöge
1504 das Kloster an sich rissen und später säkularisierten,
ließen sie es doch seinem frommen Beruf. Denn nun wurde
es in er Mitte des 16. Jahrhunderts zur evangelischen Klosterschule,
zum „Seminar“ – eine der Stätten, da
Württemberg seine begabten Söhne auf Staatskosten
für das theologische oder klassische Studium vorbereitet.
Aus Hermann Hesses Buch „Unterm Rad“ weiß
man jetzt auch außerhalb Schwabens etwas vom „Landexamen“;
noch Eindringlicheres kann man in Hermann Kurzens Meisternovelle
„Die beiden Tubus“ darüber lesen –
beide Dichter gehören übrigens auch zur Chronik
von Maulbronn.
Das
ist das Reizvolle, gleich Blaubeuren und Schöntal, wie
die katholische Tradition in eine evangelische abbiegt und
die Werke frommen Mönchtums, die Zeugnisse künstlerischer
Gestaltung, von einer nicht minder wertvollen Luft geistigen
Lebens umgeben sind. Die jungen Buben, die nun herumliefen,
zuerst auch in einer Kutte, einer dunklen Schülertracht,
stehen in herber Schulzucht; es ist ein meist erlesenes Material,
jährlich dreißig der gescheiteren Schwabensöhne,
die hier unter dem „Ephorus“ mit ein paar Professoren
und „Repetenten“ Latein, Griechisch, Hebräisch,
Philosophie betreiben, um nachher das Tübinger „Stift“
zu beziehen – die Tradition ist geschlossener als bei
den mitteldeutschen „Fürstenschulen“, an
die man denken mag. Man mag auch ein Beispiel anderwärts
sehen, Rugby, Harrow, Eton – diese sind aus dem englischen
Kulturleben nicht zu streichen. Das Schwäbische in seiner
sonderlichen Prägung ist ohne diese Seminare nicht vorstellbar.
Ist
der Klosterbau selber höchste Leistung der Baukunst,
so der weite Klosterhof ins Behagliche gewendete Romantik,
allerhand Fachwerkbau, herrischer und bescheiden gedrückter,
den riesigen Platz umgrenzend, Tor und Turm, steile Stiegen,
überhöhte Fensterbänke, eine gewaltige steinerne
Zehentscheuer, der Fruchtkasten, der Schmied, der Wagner,
der Apotheker, der Buchbinder, der Metzger, Vogelbeerbäume
mit glänzender Frucht, Kinderspiel und bedächtiger
Männer Redetausch – eine kleine Welt, die Idylle
an Idylle reiht, eine Welt, die doch nicht klein ist, weil
der Atem der Geschichte sie anbläst. Jugendparadies oder
Jugendzwang von Hunderten schwäbischer Pfarrer –
eben in jenen Tagen war eine „Promotion“ zur fünfzigsten
Wiederkehr ihres Abschieds beisammen, Landpfarrer zumeist
– die alten Herren im Abglanz der Kindererinnerung waren
rührend. Sie waren keine Ausbrecher, sie blieben im Land
und Dienst – hier in dem Hof ist es lockend, mancherlei
Lebensläufen nachzuhängen, deren Anfänge er
umzirkt hatte.
Da
sind nicht nur Kepler und Hölderlin, da ist Schelling,
da der in Württemberg fast etwas fremdartige Herwegh
(man kann ihn nicht gut ins Maulbronnische übersetzen),
da ist Friedrich Reinhard, von dem der Ephorus launig meinte,
daß er es von allen Zöglingen „am weitesten
gebracht“ habe: zeitweiliger Außenminister der
französischen Republik, napoleonischer Diplomat, der
Gesandte der restaurierten Bourbonen am Frankfurter Bundestag,
Pair von Frankreich und ehemaliger Vikar von Balingen!
(In: Badische Neueste Nachrichten,
Karlsruhe, 39. Jg., Nr. 4, 28. Jan. 1984)

|
|